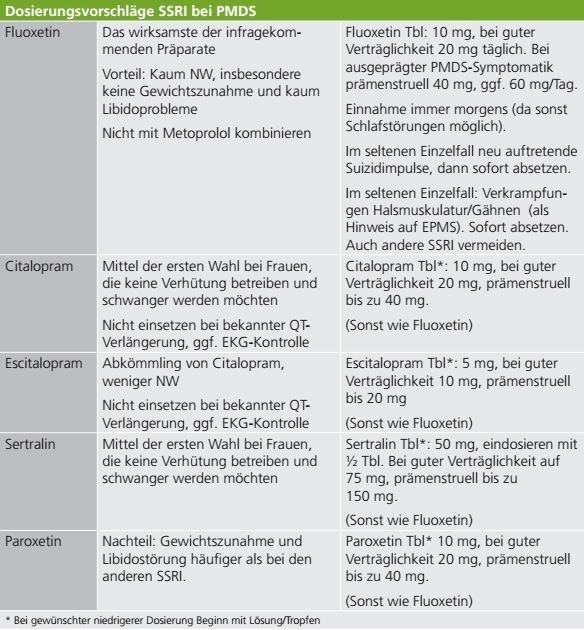Gyne 04/2019 – Ärzte und Ärztinnen zwischen Burnout und Selbstfürsorge
Gyne 04/2019
Ärzte und Ärztinnen zwischen Burnout und Selbstfürsorge
Autorin:
M. Neises

Gesund versus krank
Die Diagnose von Gesundheit oder Krankheit ist fließend und in der ärztlichen Praxis oft eine Herausforderung; dies gilt sowohl für körperliche als auch für psychische Befunde. Gensichen und Linden gehen diesem Dilemma in ihrem Beitrag „Gesundes Leiden – die Z-Diagnosen“ nach [1]. Die Grauzone hinsichtlich von Blutdruckwerten zwischen eindeutig krank bzw. eindeutig gesund ist in Abhängigkeit von Alter, Begleiterkrankungen und Untersuchungssituation genauso differenziert zu bewerten wie für depressive Syndrome bzw. Missstimmung. Vor dem Hintergrund dieser beiden Pole lässt sich sagen: Es gibt niemanden, der keine oder nie psychische Probleme hat. Betrachtet man das Spektrum negativer Gefühle, vergeht kaum ein Tag, an dem wir vielleicht nicht verstimmt, freudlos,
lustlos, traurig, bedrückt, erschöpft, frustriert oder verzweifelt sind. Lebenssituationen wie z. B. Beziehungskrisen haben das Potenzial, dieses Befinden dauerhaft zu verstärken oder auch Arbeitssituationen, in denen wir uns Bossing oder Mobbing ausgesetzt fühlen oder ausgesetzt sind. In diesem Kontext gilt es das Thema Burnout zu diskutieren.
Bei der Diagnosestellung von psychischen Erkrankungen wird das Dilemma besonders deutlich, wenn sich die Diagnose auf das Abfragen von psychischen Beschwerden stützt, ohne dass ein diagnostisches Gespräch erfolgt. So kann es leicht passieren, dass die Absenkung der Schwelle, von der an eine Krankheit angenommen wird (z. B. bei Fragebögen) die Zahl der Auffälligen erhöht. Ohne Experteninterview ist die Unterscheidung von Unglücklichsein und Krankheit oft schwer zu treffen.
Mit einer Krankheitsdiagnose verbinden sich vielfältige positive wie negative Konsequenzen. Die Zuordnung zu einer Krankenrolle kann den sogenannten sekundären Krankheitsgewinn fördern, d. h. ein Anspruch auf Rücksichtnahme, Hilfe, ggf. Freistellung von Aufgaben und die Legitimation einer Behandlung. Gensichen und Linden spitzen dies in der Aussage zu, die Behandlung eines Schwächezustandes mit Diagnose sei eine Behandlung, hingegen eine Behandlung ohne Diagnose sei Doping [1].
Die Aufgabe, Krankheit von subjektivem Leid aufgrund von Belastungen abzugrenzen, ist in der Medizin eine wichtige und auch schwierige Aufgabe. Genauso wichtig ist es aber auch, „alltägliche Beschwerden“ als Erleben im Bereich des Gesunden zu benennen. Ein überzeugendes Beispiel ist der Dermatologe, der einen Leberfleck feststellt und diesen als gesund diagnostiziert in Abgrenzung von einem Melanom. Diese Expertise braucht es in besonderer Weise auch, wenn es um psychische Belastungen und Probleme geht. In der Medizin tun sich Ärzte und Ärztinnen oft schwer mit der Feststellung, dass keine Krankheit vorliegt. Auch Patienten haben oft Schwierigkeiten, eine solche, vielleicht konfrontativ vorgetragene Einschätzung zu akzeptieren. Hilfreich ist die Empfehlung, die in den Kursen der Psychosomatischen Grundversorgung gegeben wird, zu beschreiben, was als gesundes Organ eingeschätzt wurde, statt zu sagen: „Sie haben nichts“.
Im psychischen Bereich können Müdigkeit und Erschöpfungsgefühle völlig angemessene Reaktionen sein auf Schlafdefizite oder auf lange Arbeitstage und Nachtdienste. Sie können aber auch Symptome vielfältiger Krankheiten sein, von Schlafstörungen und Depressionen bis hin zu Karzinomerkrankungen. Dass der Ausschluss einer differenzialdiagnostischen Überlegung oft langwierig und kostenintensiv ist, liegt auf der Hand.
Die sogenannten Z-Codes wurden in diesem Übergangsbereich eingeführt, sie umfassen z. B. Probleme am Arbeitsplatz, in der Familie und in der Lebensführung oder auch unspezifische Beschwerden ohne Krankheitswertigkeit. In den letzten Jahrzehnten hat diese Kategorie insbesondere mit der Diskussion um das Burnout-Syndrom zunehmende Aufmerksamkeit erfahren. Die Z-Diagnosen bieten so die Möglichkeit, auf einem Kontinuum zwischen Krankheit und „gesunden Leidenszuständen“ eine für den Patienten bedeutsame klinische Situation zu beschreiben, ohne eine medizinische Überversorgung inGang zu setzen und auch ohne die Betroffenen durch eine voreilige Diagnose zu beunruhigen. In der täglichen medizinischen Praxis verdienen diese Z-Kategorien mehr Aufmerksamkeit. Als subjektives Krankheitsmodell erleichtert ein solches Verständnis den Betroffenen, ihre Problematik zu reflektieren, zu kommunizieren und unter Umständen auch um Hilfe zu suchen.
Dieses selbstwahrgenommene Überschreiten einer Belastungsgrenze kann durchaus positive Konsequenzen haben, wenn damit einWeg gefunden wird, Belastungen, Symptomeund eigene Grenzen als solche zu reflektieren und Hilfen in Anspruch zu nehmen, sei es durch Beratung, ggf. auch durch psychotherapeutische Behandlung. Insofern ist auch im psychotherapeutischen Kontext der Begriff des Burnouts nützlich, kann er doch helfen einen Zugang zum Patienten/zur Patientin zu finden und ihm/ihr Verstehen und Akzeptieren vermitteln. Das Leiden der Betroffenen sollte aber darüber hinaus nicht dazu verleiten, gewissermaßen aus Solidarität Burnout mit einer Diagnose zu verwechseln, die die Ursache der Überforderung überwiegend im Außen sucht.
Definition und begriffliche Abgrenzung
Den Begriff Burnout hat Freudenberger 1974 eingeführt [2], der als Holocaust-Überlebender in die USA immigriert und als Psychoanalytiker in New York mit hohem Engagement für soziale Randgruppen tätig war. Von ihm wurde die Burnout-Symptomatik insbesondere als Ausdruck einer Überlastungskonstellation, d. h. als Erschöpfungssyndrombeschrieben.
Seither wird Burnout als Synonym für psychische, psychosomatische und soziale Folgen, langandauernder, das individuelle Leistungsvermögen übersteigender beruflicher Belastungen, angesehen. Vielfach wird der Begriff als Diagnoseäquivalent benutzt, obwohl er in der ICD10 lediglich als Zusatzkodierung Verwendung findet.
Ditzler nennt als die drei Kardinalssymptome des Burnouts-Syndroms anhaltende Erschöpfung, Depersonalisation und das Gefühl der reduzierten Leistungsfähigkeit [3]. Diese werden als Ausdruck einer chronischen Stressreaktion angesehen, wobei Burnout das Ergebnis eines längeren Prozesses ist, der sich aus Arbeitsbelastung, empfundenem Stress und psychologischer Anpassungsfähigkeit zusammensetzt. Das Geschehen lässt sich wie in Abbildung 1 zusammenfassen.
Das mit diesem Begriff beschriebene Syndrom wird mit zahlreichen Symptomen in Verbindung gebracht ( Tab. 1), wobei die drei Hauptsymptome immer wieder unter starker Kritik stehen. Danach sei lediglich emotionale Erschöpfung als Symptom einzustufen, während Depersonalisation/ Zynismus eher als Copingstrategie und verringerte subjektive Leistung als Resultat auf chronischen Stress zu bewerten seien [4].
Die Leistungsabnahme spielt bei Ärzten bei anfänglichem Burnout im Vergleich zu anderen Berufsgruppen eine untergeordnete Rolle, diese ist das schwächste Diagnosekriterium. Die eigene Leistungsorientierung als Ressource verhindert bis zu mehr als einem Jahrzehnt den kompletten Zusammenbruch trotz Burnout. So sind nach Bergner Ärzte seit ihrem Studium darauf trainiert ihrenWillen einzusetzen [5].
Notwendig ist eine begriffliche Abgrenzung zur beruflichen Sinnkrise, die ebenfalls auftreten kann aufgrund von Überarbeitung, Überforderung, Zeitdruck und auch fehlende Anerkennung oder schlechte Bezahlung und persönliche Konfliktfelder, wenn z. B. eigene Bedürfnisse und familiäre Verpflichtungen nicht mehr oder nur unzureichend miteinander vereinbar sind. In der Konsequenz kann Burnout auch als die Sinnfrage im persönlichen Leben angenommen werden. Um sich dieser Frage zu nähern, ist es wichtig, zu erkennen, welche Rollen wir ausführen möchten und welche individuellen Ziele wir haben.
Bei Konflikten im interpersonellen Bereich wird von „Mobbing“ gesprochen.
Gesellschaftliche Aspekte
Burnout wird in der gesellschaftlichen Diskussion seit den 1970er Jahren genutzt, wobei dies ohne die sonst mit psychischen Störungen verbundene Stigmatisierung geschieht. Ditzler formuliert: „denn nur der ist ausgebrannt, der einmal für seine Arbeit gebrannt hat“ [3]. Insbesondere auch für die Medien, die dieses Thema aufgreifen, wurde eine neue Volkskrankheit ausgerufen. Die Popularität von Burnout verweist jedoch auf vitale Bedürfnisse und Nöte einer im Wandel begriffenen Gesellschaft, in der viele durch Veränderungen vor allem in der Arbeitswelt belastet und existenziell bedroht sind.
Schließlich gibt es auch im Hintergrund unserer westlichen Industriegesellschaft grenzwertige Gesundheitsbelastungen, die mit unserem Lebensstil zusammenhängen. Dazu gehören Bewegungsmangel, Fehlernährung und chronischer Stress bei gleichzeitigem Verlust von traditionellen sozialen Beratungs- und Stützungsfunktionen (z. B. durch eine Mehrgenerationenfamilie). Bei zunehmender Individualisierung oder Reduktion der Familienstrukturen auf zwei bis vier Personenhausalte, fehlen wohlmeinende Bezugspersonen, die bei körperlichen Beschwerden oder eskaladierenden Beziehungsauseinandersetzungen Rat geben können, ohne „sofort“ medizinische Dienste aufzusuchen.
Arbeitswelt
In der gesellschaftlichen Entwicklung mit zunehmender Globalisierung bei gleichzeitig unsicheren und stressbelasteten Arbeitsverhältnissen entsteht in soziokultureller Hinsicht die Voraussetzung, dass Burnout zu einem Phänomen unserer Zeit werden konnte. Es liegen hinreichend arbeitspsychologische Untersuchen vor, die unter dem Stressparadigma keinen Zweifel daran lassen, dass bestimmte Konstellationen gesundheitsschädliche Auswirkungen haben [6]. Je höher das Arbeitstempo und je weniger Kontrollmöglichkeiten eine Person hat, je geringer die erlebte Anerkennung ist und je unsicherer der Arbeitsplatz, umso höher ist das Risiko, psychosomatische Erkrankungen bzw. Stress-Symptome zu entwickeln. Von 2001 bis 2005 stieg der Anteil der durch psychische Störung bedingten AU-Tage von 6,6 auf 10,5%an. Bei unter 50- Jährigen stehen depressive Störungen als Frühberentungsgrund mittlerweile an zweiter Stelle. Wer diesem Druck nicht mehr standhalten bzw. die erhaltenen Gratifikationen in Relation zum persönlichen Einsatz als zu gering erlebt, für den ist Burnout ein Stress-Symptom, mit dem sich die erlebten Beeinträchtigungen plausibel erklären lassen.
Unklarheiten bzgl. der Arbeitsplatzaufgaben und der Ziele sowie konfliktreiche Interaktionen am Arbeitsplatz stellen ein Risikomerkmal dar, wie auch geringe Wertschätzung und berufliche Gratifikationskrisen. Schließlich ist auch Arbeitsplatzunsicherheit ein relevanter Burnout-Risikofaktor.
Nicht zuletzt ist der Krankenstatus von vielfältigen sozialen Ursachen abhängig, mit Rückwirkung auf das soziale Umfeld. So gibt es eine Beziehung zwischen Betriebsklima und Arbeitsunfähigkeitsraten. Es ist naheliegend anzunehmen, dass ein Mitarbeiter, der sich vom Chef oder seinen Kollegen schikaniert, missachtet, degradiert oder ausgenutzt fühlt, bei entsprechenden Rückzugstendenzen in seiner Persönlichkeit den Ausweg suchen wird, vom Arbeitsplatz fernzubleiben. Dazu genügen u. U. beliebige körperliche oder psychische Klagen, um eine Krankschreibung zu erreichen. In vieler Hinsicht wird diese „Konsumentenhaltung“ gegenüber Gesundheitsdiensten oft kritisiert. Schließlich darf auch der Beitrag von Medienmeinungen und Einstellungen der gesamten Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Gibt es doch immer wieder Diagnosen, die in den Medienfokus rücken, sei es die Depression, sei es das Trauma oder auch Burnout und so zu einer verstärkten Selbstbeobachtung bis hin zu einer Hypochondrisierung bei dem Einzelnen führen.
Die negativen Folgen einer Diagnosestellung insbesondere bei einer psychischen Erkrankung können dazu führen, dass die gesundheitlichen Probleme aggraviert werden, Betroffene sich zunehmend Sorgen um ihren Gesundheitszustand machen und damit Fähigkeiten der Selbstheilung/ Resilienz eher gelähmt werden.
Last but not least kann es zu überflüssigen oder gar schädlichen Behandlungen führen. Gerade unter dem Etikett der psychischen Erkrankungen finden sich in unserer Berufswelt zunehmend Frühberentungen und auch heute spielen noch soziale Stigmatisierungen eine Rolle. Dieses Pro und Kontra gilt bei jeder Diagnose, seien es Rückenschmerzen oder Burnout.
Zufriedenheit im ärztlichen Beruf
Zufrieden oder resigniert mit ihrem Beruf sind 78 %aller deutschen Vertragsärzte, 58 %würden kein Vertragsarzt mehr werden und 37 % würden sogar ihren Beruf heute nicht mehr ergreifen [7]. Die Unzufriedenheit im Arztberuf hat vielfältige Gründe. Dazu gehören in absteigender Häufigkeit:
– das Arzt-Bild in den öffentlichen Medien
– fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten
– unzureichendes Netz eigener sozialer Sicherheit
– Arzt-Bild in den Fachmedien
– Arzt-Bild in der Gesellschaft
Wird dagegen gefragt, was zu mehr Zufriedenheit in dem Beruf führen würde, sind dies:
– adäquate Zahlung und Prämien
– ein gutes Arbeitsklima
– Fortbildungsmöglichkeiten
– Unterstützung von Kollegen und durch Supervision
– funktionierende Kommunikation
– Arbeitsplatzsicherheit
Selbstzuschreibung
Menschen, die sich als besonders engagiert einschätzen, äußern z. B. „…ich hatte zu viele Aufgaben, andere sind krankgeworden, ich habe alles gemacht, hatte dazu noch einen Nebenjob, jetzt sind meine Batterien leer…“. So kann sich jeder Betroffene und in diesem Sinne auch Leidende selbst diagnostisch und ohne, dass ihn Experten durch Sachargumente davon abbringen können, mit dem Phänomen identifizieren.
Auf der anderen Seite ist es ein „Krankheitsmodell“, das das individuelle Selbstwertgefühl eher stabilisiert, während dies sonst bei psychischen Erkrankungen zusätzlich labilisiert werden kann. Oft ist es mit der Haltung verbunden „mich trifft keine Schuld, ich habe zu viel geleistet, die Umstände waren gegen mich, vom Vorgesetzten oder von Kollegen wurde ich außerdem noch ausgenutzt…“ So sehen sich die Betroffenen als Opfer ihrer verzweifelten Bemühung, den überhöhten und ständig wachsenden Anforderungen eines sich verändernden Berufslebens gerecht zu werden. Die Zuschreibung Burnout beinhaltet nicht nur das Eingeständnis des eigenen Zusammenbruchs, sondern auch eine mehr oder weniger versteckte Anklage gegen eine krankmachende und als unmenschlich verstandene Berufswelt oder Gesellschaft [8].
Die entscheidende Ausgangssituation ist wie der einzelne Mensch sich selbst wahrnimmt und einschätzt, sowie sein Inanspruchnahmeverhalten, sei es gegenüber Beratungsstellen oder medizinischen Einrichtungen. Individuen, die sich durch ein stabiles Selbstwertgefühl, innere Kontrollüberzeugungen (im Sinne von Zutrauen in eigene Fähigkeiten) und hoheWiderstandsfähigkeit (Resilienz) auszeichnen, sind vergleichsweise Stress- und Burnout-resistent. Demgegenüber konnten externale Kontrollüberzeugungen im Sinne eines Sich-Ausgeliefertfühlens (Neurotizismus, Ängstlichkeit, Feindseligkeit, Depressivität, geringe Selbstsicherheit und Vulnerabilität) sowie familiäre Belastung mit psychischen Störungen als Burnout-Risikofaktoren identifiziert werden.
Operationalisierung: Wie lässt sich Burnout messen?
Entsprechend aktuellen diagnostischen Standards lassen sich weder die Symptomatik noch ihre Ursachen zusammenfassend reliabel operationalisieren. Im Gesundheitssurvey für Erwachsene, DEGS des Robert- Koch-Instituts, wird nachgefragt, ob ein Burnout-Syndrom von einem Arzt oder Psychotherapeuten festgestellt wurde. 4,2%der Befragten gaben an, dass ein Burnout-Syndrom bestand [9].
In verschiedenen Untersuchungen waren Burnout-Betroffene sowohl psychologisch als auch neurophysiologisch heterogen. Es finden sich sowohl ehemals engagiert kompetente sowie von Berufsbeginn an überforderte Personen gegenüber.
Maslach et al. [10] bemühten sich um eine Definition des Phänomens, ausgehend von der Frage, wie es in sozialengagierten Berufen gelingen kann, Balance zwischen Mitgefühl und professioneller Distanz zu halten. So identifizierten sie als die zentralen Dimensionen emotionale Erschöpfung, reduzierte Leistungsfähigkeit und Depersonalisation, d. h. eine distanzierte Haltung zu Patienten/ Klienten (diese weniger als Menschen, sondern mehr als unpersönliche „Objekte“ wahrzunehmen).
Von dieser Arbeitsgruppe wurde das Messinstrument MBI, Maslach- Burnout-Inventar entwickelt, das bis heute am weitesten verbreitete Burnout-Messinstrument. Es gibt z. B. in der Skala emotionale Erschöpfung ein Item „ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt“. Dies ist auf einer Sechser-Skalierung zu beantworten zwischen 1 „einige Male im Jahr“ bis 6 „täglich“. Auch wenn der MBI inzwischen umfangreich bei verschiedenen Berufsgruppen eingesetzt wurde, ließ sich kein exakter Cut-off-Wert identifizieren, um eine Differenzierung im Sinne von Gesund versus Krank vorzunehmen. So ist es möglich, einen individuellen Skalenwert entsprechend verschiedenen Vergleichsgruppen zuzuordnen, ohne dass aber eine klinische Wertung möglich ist. Bei verschiedensten befragten Kollektiven, wie z. B. Ärzte, Lehrer, Manager, fanden sich jeweils 20–30% Burnout- Gefährdete, andererseits ist es nicht möglich, keine Punkte auf der Burnout-Skala zu haben.
In Untersuchung mit dem MBI-Fragebogen korrelierten die erhobenen Daten relativ hoch (0,3–0,7) mit Stresserleben und Arbeitszufriedenheit, mit Depression bzw. Depressivität und mit neurotischen Persönlichkeitsmerkmalen bzw. Neurotizismus (Ängstlichkeit, emotionale Labilität). Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse bleibt zu betonten, dass Burnout keine eigene/abgegrenzte Kategorie abbildet. Auch das oft damit in Zusammenhang gebrachte Ideal oder auch als positives Selbstverständnis geäußerte „idealistischhochengagiert“ und sich dabei im Beruf „verzehrend“ wird mit solchen Ergebnissen deutlich widerlegt, aber in der öffentlichen Diskussion kaum zur Kenntnis genommen“ [11].
In anderen Konzepten ginge es mehr um die Art der Bewältigung von beruflichen Belastungen von gesunden Personen. Andere Arbeitsgruppen untersuchten Burnout als Vorstufe oder Variante von psychosomatischen Störungen. Von einer niederländischen Arbeitsgruppe wird Burnout als arbeitsbedingte Form der Neurasthenie aufgeführt. Andere Arbeitsgruppen versuchen arbeitsbezogenes Engagement, Problembewältigungsstrategien und berufsbegleitende Emotionen abzubilden. Keinem dieser Konstrukte ist es gelungen, ein umschriebenes krankheitswertiges Phänomen zu erfassen (zur Übersicht siehe [11]).
Mit all diesen Ansätzen lässt sich schließen, dass Burnout ein komplexes Phänomen ist, dem problematische Interaktion zwischen Individuum und Arbeitsplatzmerkmalen zugrunde liegen. Nach Ergebnissen des BMI-Fragebogens haben jüngere Personen höhere Werte als ältere und unverheiratete höhere als verheiratete Menschen im Sinne von stärkerer Belastung.
Burnout-Verlauf und Behandlung
Burnout wurde ursprünglich als arbeitsbezogenes Syndrom mit einer vielfältigen psychischen Symptomatik beschrieben, ohne dass nach ICD10 oder DSM4 eine Krankheitsdiagnose besteht. Jedoch kann bei chronischem Verlauf am Ende auch eine psychische Erkrankung stehen, wie z. B. eine Depression, eine Angst- oder Panikstörung oder eine Suchterkrankung. Von verschiedenen Autoren wird die prozesshafte Entwicklung über mehrere Phasen beschrieben bis hin zu einem Zustand mit anhaltender Erschöpfung, Überdruss, Leistungsinsuffizienz und Resignation. Dabei geht es nicht nur um ein Problem der individuellen Bewältigung oder Anpassung, sondern es werden auch die gesellschaftlichen Bedingungen ins Spiel gebracht. Diese werden oft in dem Kontext der modernen Leistungs- und zunehmenden Informationsgesellschaft dargestellt, in welcher der ständige Versuch, alles zu wissen, zu können und zu beherrschen zu einer kollektiven Ermüdung führt, Han [12] spricht in seinem Buch von der „Müdigkeitsgesellschaft“.
Die Unklarheit des Burnout-Syndroms zeigt sich auch in seiner angenommenen Entwicklung. Diese reicht von einem 2- bis 10-Phasen- Modell. Demnach beginnt Burnout entweder mit idealistischer Begeisterung oder aber mit Berufsstress, Überforderungserleben und/oder chronischer Müdigkeit. Die zwei Stufen beschreiben ein empfindendes und ein empfindungsloses Stadium. Hillert und Marwitz [13] nennen ein Zehn-Phasen-Stadium:
1. Freundlichkeit und Idealismus
2. Überforderung
3. Geringer werdende Freundlichkeit
4. Schuldgefühle
5. Vermehrte Anstrengung
6. Erfolglosigkeit
7. Hilflosigkeit
8. Hoffnungslosigkeit
9. Erschöpfung, Distanzierung,Wut
10.Burnout
In welchen Phasen Burnout erfolgt, ist letztendlich nebensächlich.Wichtig ist dasWissenumdie anfängliche Hyperaktivität, welche wenige Wochen bis Jahre andauern kann. Dafür lässt sich beispielshaft ausführen, dass Betroffene gerade in solchen Phasen auch noch neue Tätigkeiten annehmen. Möglichst viel arbeiten, oft von zu Hause aus, was mit zunehmender Onlinevernetzung auch ein zunehmendes Risikopotential in sich birgt. Diese Hyperaktivität kann in dem Gefühl, unentbehrlich zu sein, anfangs einen hohen Benefit enthalten. Dieses „ohne-mich-geht es-nicht-Gefühl“ korrespondiert nicht selten mit einem labilen Selbstwertgefühl neben Stimmungsschwankungen. Es werden Kompensationen gesucht, die oftmals im Materiellen liegen, d. h. die Einnahmenseite wird gesteigert, aber genauso auch die Ausgabenseite. Die „aufopfernde Hyperaktivität“ kann dem Arbeitsgeber durch eine hohe Leistungsausbeute bei anfänglichem Burnout nutzen. Letztlich dient sie damit dem Gesundheitssystem, wofür Millionen unbezahlter Überstunden in deutschen Kliniken sprechen, die jedes Jahr aufgebaut werden [14, 15].
In der Behandlung von Burnout [5] zeigt sich, dass die Aktivierung der eigenen Ressourcen stärker gegen Burnout wirkt als Maßnahmen wie z. B. Beratung. Oft hat das Syndrom eine längere Vorgeschichte, weil die Symptome anfangs nicht wahrgenommen oder verleugnet werden.
Nicht selten sind es die somatischenSymptome, die zu einer Abklärungführen. Therapie und Coachingmaßnahmenunterscheiden sich von denPräventionsmaßnahmen dann, wennBurnout fortgeschritten ist. Sollte bereitseine Suchtproblematik eingetretensein, ist eine anfänglich stationäre Therapie ratsam und erst danachsollte ambulant weiterbehandelt werden. In der wissenschaftlichen Literatur kommt häufig die Verhaltenstherapie zur Anwendung bei Burnout. Allerdings lässt sich keine Methodenpräferenzexakt definieren,d. h. es kommen sowohl verhaltenstherapeutische als auch psychodynamische Verfahren zur Anwendung(_ Abb. 2).
In einem ersten Schritt geht es immer darum, was die Betroffenen selbst umsetzen können, danach steht dieFrage, wer braucht psychotherapeutische Hilfe zur Umsetzung und erst in einem dritten Schritt folgt die Entscheidungzu einer Psychotherapie.
Burnout-Prävention
In die Burnout Prävention muss der Körper einbezogen werden, d. h.sich körperlich weder unter- noch überfordern, Bewegung und Sporttreiben, genügend Schlaf und gesunde Ernährung. Bergner [5] stellt eine Liste präventiver Maßnahmen vor.
1. Stresstoleranz (Veränderungdes Stressempfindens)
Burnout ist als Stresserkrankung definiert, dennoch reichen übliche Stressverminderungsprogramme nicht aus. Erklärt wird dies in der Kombination von Unzufriedenheit im Beruf mit Stresserleben. Erst wenn beides zusammen kommt, steigt das Burnout Risiko stark an. Es geht darum konkre therauszuarbeiten, welche Ursachen die Unzufriedenheit hat.
2. Zeitsouveränität (Veränderungim Umgang mit Zeitnot)
Die Zeitnot ist ein Hauptindikator, der von den Betroffenen oft vorrangig angegeben wird. Dieses Thema zu bearbeiten, heißt auch, über übliche Zeitmanagementprogramme hinaus zu gehen, da Ärzte oft dicht getaktete wichtige Termine wie beispielsweise Patiententermine in Ambulanzen und Praxen haben. D. h. Ärzte brauchen ein funktionierendes Terminmanagement, das die typische Aufgabenstrukturierung berücksichtigt:
– Was muss ich sofort tun, waskann ich delegieren?
– Was lege ich auf einen Termin?
– Was lasse ich ganz bleiben, was verändere ich?
Darüber hinaus geht die Frage nachden Lebenszielen:
– Wofür möchte ich mir Zeit nehmen?
– In welcher Zeit meines Lebens befinde ich mich?
– Gehe ich mit genügend Selbstrespekt mit meiner Zeit um, bringe ich der Zeit anderer den notwendigenRespekt gegenüber?
3. Aufbau von Situationsttoleranzim Sinne von Abbauen unerträglicher Situationen
Bergner [5] differenziert danebenaufbauende und erkennende Komponenten:
– Eine sog. „Dyadenkompetenz“, d. h. Steigerung der interpersonellen Kompetenz. Burnout tritt gehäuft in Berufen auf, die mit Belastungen, Leiden und Erwartungen eines Gegenübers zu tun haben, neben den Erwartungen an sich selbst. So sind es nebenÄrzten und Therapeuten oder Pflegekräften auch Erzieher, Lehrer und Sozialarbeiter, bei denen intensive Gesprächsinhalte einen Einfluss auf die emotionale Regulationsfähigkeithaben [16]. Burnoutprävention muss sich deshalb auch mit der Verbesserung der Fähigkeit im Umgang mit zwischenmenschlichen Kontakten und der emotionalen Kompetenzbefassen.
– Eigenbestimmtheit stärken, Aufbau der Selbstwirksamkeit und des Selbstbewusstseins
– Aufbau eines konstanten Maßes an persönlicher Zufriedenheit.
Schließlich geht es um die sogenanntenerkennenden Komponenten:
– Rollensicherheit, d. h. erkennen,welche Rolle ich spiele und welche nicht. Bei Ärzten ist die Entscheidung,den Arztberuf zu ergreifen, sehr oft mit einer sehr persönlichen Vorgeschichte verbunden: Dies kann die Vorgabeder Herkunftsfamilie sein, z. B.die Praxis von Vater oder Mutter zu übernehmen, eine gute Abiturnote aus der Perspektive des sozialen Umfeldes sinnvoll zu nutzen oder aus eigener Krankengeschichte. In der Auseinandersetzung mit einem Burnout-Syndrom kann es darum gehen, sich diese inneren und äußeren Konflikte klar zu machen und u. U. im beruflichen Kontext neue Entscheidungen zu treffen.
– Zielerkenntnisse, d. h. das Erkennen der mittel- und langfristigen Ziele. Diese u. U. existenzielle Frage zielt auf das, was ich will und nicht darauf, wie ich es ausfüllen oder leben will. Ziele für sich zu definieren, heißt auch, Erfolg haben zu können und aus dieser Selbstgewissheit und Selbstwirksamkeit heraus innere Stützung und Stärkung zu erfahren. Es ergibt also Sinn, sich Ziele zu setzen und deren Erreichen anzustreben, zu realisieren und auch zu feiern. Dabei ist es wichtig, den Blick umzulenken von immer neuen materiellen Zielen zu dem, was die Motivation war, in den Arztberuf zu gehen. Gerade Ärzte verlieren durch die oft anstrengende und wiederkehrende Routine im Tagesablauf aus dem Blick, sich immer wieder neuen Zielen und Herausforderungen zu stellen. Die Arbeit an der eigenen Zielorientierung kann auch bedeuten, zu entscheiden, welche Tätigkeiten oder bisherige Ziele aufgegeben werden sollten.
– Sinnannäherung, d.h. erkennen, worum es im eigenen Leben geht, sich der Fähigkeit stellen, mit den eigenen Werten, Wünschen, Bedürfnissen und Zielen auseinanderzusetzen und dies im Einklang mit einem sicheren Selbstbild zu leben. Sich der der Sinnfrage zu stellen kann sowohl eine spirituelle Dimension eröffnen, aber auch eine bescheidene Antwort nach sich ziehen. In der Rückschau wird oft deutlich, dass vieles von dem, was zu einem Burnout geführt hat, sinnlos war.
Man sollte nicht auf ein Burnout oder eine Krankheit warten, bis man sich die Zeit nimmt, diese Fragen zu stellen, sondern sehr viel früher und immer wieder mit wichtigen Anderen darüber ins Gespräch gehen.
Selbstfürsorge
Der Weltärztebund verabschiedete in einer überarbeiteten Fassung 2017 die Deklaration von Genf, der der Deutsche Ärztetag sich einstimmig „mit großem Applaus“ angeschlossen hat [17]. Neu und beachtenswert daran ist, dass Ärztinnen und Ärzte auf ihre eigene Gesundheit achten sollen und sich für den Erhalt ihrer Fähigkeiten einsetzen sollen. Im Folgenden ein Auszug aus der Deklaration:
– Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen.
– Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein.
– Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren.
– Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichen Leben wahren.
– Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung oder Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten.
Dieser letzte Punkt bekommt aktuell vor dem Hintergrund weltpolitischer Krisen verbunden mit Migration und Flucht von Menschen besondere Bedeutung. Der folgende Link weist in der deutschen Übersetzung durch die Bundesärztekammer auf den vollständigen Text hin (https://www. bundesaerztekammer.de/fileadmin/ user_upload/downloads/pdf-Ordner/ International/Deklaration_von_Genf _DE_2017.pdf).
Der bemerkenswerte Punkt hinsichtlich der ärztlichen Selbstfürsorge lautet:
– Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können.
Dieser Passus ist in der 2017 revidierten Fassung der Deklaration von Genf neu und weist hin auf ein deutlich mehr ins Bewusstsein gerücktes Spannungsfeld zwischen physischer und mentaler Selbstfürsorge, Lebensqualität und hochprofessionellem Handeln. Möglicherweise sind wir auf diese Doppelaufgabe, d. h. Behandlung unserer Patientinnen und Patienten auf höchstem Niveau, aber auch die eigene Gesundheit und unser Wohlergehen im Blick zu haben, noch nicht hinreichend gerüstet.
Im beruflichen Umfeld prägen Komplexität, Beschleunigung und Aufgabenverdichtung zunehmend die Arbeitswelt jedes Einzelnen und haben Auswirkungen auf unseren persönlichen Alltag, sodass nicht wenige Ärztinnen und Ärzte Überforderung und „Arbeit am Limit“ erleben. Schon im Studium ist Burnout und Arbeitsstörung ein relevantes Thema in Abhängigkeit vom erlebten Zeitdruck [18]. Gleichzeitig lässt sich im Studium beobachten, dass Empathie zurückgeht, was mit einer hohen Studienbelastung und fehlenden ärztlichen Vorbildern begründet wird. Ärztinnen und Ärzten kann es schwerfallen, Gefühle wahrzunehmen, zu beschreiben und erst recht aus negativen Gedankenspiralen auszusteigen. Wie in allen Berufen mit sozialer Zuwendung sind sie gefährdet, sich emotional zu erschöpfen und letztlich in Abwehrstrategien zu gehen, die den Kontakt zu ihren Patienten erschweren oder sogar verlieren lassen. Es kann geschehen, dass die einzig verbleibende Strategie in Ironie und Sarkasmus liegt oder dass selbstschädigende Belastungen durch Alkohol kompensiert werden. Diese Maladaptation sollte Ärzte und Ärztinnen „in besonderer Weise sensibilisieren und motivieren, Techniken zu erwerben und Haltungen zu kultivieren, die dem entgegenwirken“ [17].
Zu dieser Art der Kompensation gehört es, Fähigkeiten der Resilienz zu kultivieren. Resilienz wird in der Psychologie als eine ArtWiderstandsfähigkeit verstanden. Methoden der Achtsamkeit und Meditation können hilfreich sein, wie z. B. Tang [19] bezogen auf die Stress-Reduktion und Gesundheits-Förderung nachweisen konnte. Kabat-Zinn hat in den 80er Jahren achtsamkeitsbasierte Übungen für Behandlung der Hypertonie und von chronischem Schmerz eingeführt [20]. Im Rahmen der neurowissenschaftlichen Forschung wurden seit den 90er Jahren bei Menschen die regelmäßig meditierten Veränderungen im Gehirn belegt, verbunden mit positivem Einfluss auf Alternsprozesse des Gehirns [21].
Die Konsequenz dieses Wissen für Ärztinnen und Ärzte sollte sein, sich den beschriebenen Themen der Selbstwahrnehmung und Selbstfür sorge zu öffnen. Schon im Studium oder später in der Weiter- und Fortbildung – auch in Qualitätszirkeln – sollte dieses Thema im Sinne eines „persönlichen Werkzeugkastens“ Beachtung finden.
Zusammenfassung
Wir leben in einer Zeit der Arbeitsverdichtung und der Informationsüberflutung bei gleichzeitiger Vereinzelung des Individuums. Auf diesem Boden entstehen Begrifflichkeiten jenseits von Krankheitsdiagnosen, wie z. B. das Burnout-Syndrom. In der ICD10-Klassifikation ist dieses als sogenannte Zusatz-Diagnose eingeordnet. Damit werden Faktoren beschrieben, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen. Z73 beschreibt ein breites Spektrum von Problemen, die verbunden sind mit Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung und Z73.0 bezeichnet ein Erschöpfungssyndrom (Burnout-Syndrom), in dem sich Überlastung und Überforderung äußert. Umgangssprachlich ist Burn-out inzwischen ein viel genutzter, wie manchmal in Institutionen oder auch von einigen Autoren bemängelt, ein missbrauchter Begriff.
In der Literatur wird das Thema bei Ärzten und Therapeuten im Zusammenhang mit beruflichen Belastungen und Überforderungen diskutiert, etwa durch schwer kranke Patienten oder solche, die fordernd aggressiv auftreten oder nicht kooperieren.
Dieser Beitrag soll zu einer Begriffsklärung beitragen und jenen, die sich in einem solchen Spannungsfeld erleben, auch Strategien zur Prävention an die Hand geben. So erhöhen z. B. Supervision und Fortbildung nicht nur die Kompetenz, sondern dienen auch der emotionalen Entlastung und werden daher als präventive Maßnahmen gegen Burnout beschrieben. Entsprechend der Genfer Deklaration (2017) sollte neben einer hohen Qualität ärztlichen Handeln auch die Lebensqualität und dasWohlergehen der Ärzte und Ärztinnen gefordert und gefördert werden.
Schlüsselwörter: Burnout, Symptomatik, Verlauf, Behandlung, Prävention, Frauenärztinnen und Frauenärzte
Korrespondenzadresse:
Prof. apl. Dr. rer. nat. Dr. med. Mechthild Neises
Lemierser Berg 119
52074 Aachen
Tel.: +49 (0)241 90078507
info@mechthild-neises.de
www.mechthild-neises.de

Literatur:
1. Gensichen J, Linden M. Gesundes Leiden – die „Z-Diagnosen“ Dtsch. Ärztebl 2013; 110: A70–72
2. Freudenberger J H. Staff Burn-out. Journal of Social Issues 1974; 30: 159–165
3. Ditzler K. Berufliche Sinnkrise und Burnout bei Ärzten. Frauenarzt 2013; 54: 1185–1161
4. Dörr J, Nater U. Erschöpfungssyndrome – Eine Diskussion verschiedener Begriffe, Definitionsansätze und klassifikatorischer Konzepte. Psychother Psych Med 2013; 63: 69–76
5. Bergner TMH. Burnout-Prävention für Ärzte und Therapeuten. Ärztl Psychother 2008; 4: 243–250
6. Siegrist J, Rödel A. Chronischer Distress im Erwerbsleben und depressive Störungen. In: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.): Arbeitsbedingtheit depressiver Störungen. WirtschaftsverlagNW2005: 27–37
7. Bestmann B, Rohde V, Wellmann A, et al. Zufriedenheit von Ärztinnen und Ärzten. Dtsch Ärztebl 2004; 101: A28–32
8. Rudolf G. Opfer-Überzeugungen. Die „neuen“ Störungsbilder – Faszination und Schwierigkeiten. Forum Psychoanalyse 2012. DOI 10.1007/s00451-012-0120-1
9. Kurth B-M. Erste Ergebnisse aus der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS). Bundesgesundheitsbl 2012; 55: 980–990
10. Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. The Maslach Burnout Inventory Manual. 2nd Ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press 1996
11. Hillert A, Marwitz M. Burnout: Eine Kritische Analyse mit therapeutischen Implikationen. Ärztliche Psychotherapie 2008; 4: 235–241
12. Han B-C. Müdigkeitsgesellschaft. Matthes & Seitz, Berlin 2010
13. Hillert A, Marwitz M. Die Burnout-Epidemie. Oder brennt die Leistungsgesellschaft aus? Beck, München 2006
14. Bergner T. Burnout-Prävention. Schattauer, Stuttgart 2016, 3. Aufl.
15. Bergner T. Burnout bei Ärzten. Lebensaufgabe statt Lebens-Aufgabe. Dtsch Ärztebl 2004; 101: 1866–1868
16. Zammuner VL, Galli C. Wellbeing: causes and consequences of emotion regulation in work settings. Int Rev Psychiatry 2005; 17: 355–364
17. Vogelsänger P. Das ärztliche Gelöbnis. Ärztl Psychotherapie 2018; 13: 256–259
18. Gumz A, Erices R, Brähler E, Zenger M. Faktorstruktur und Gütekriterien der deutschen Übersetzung des Maslach-Burnout-Inventars für Studierende von Schaufeli et al. (MBI-SS) Psychother Psych Med 2013; 63: 77–84
19. Tang YY, Hölzel BK, Posner MI. The neuroscience of mindfulness meditation. Nat Rev Neurosci. 2015 Apr; 16(4): 213–25
20. Kabat-Zinn J. Gesund durch Meditation. Knaur, München 2019
21. Ramírez-Barrantes R, Arancibia M, Stojanova J, Aspé-Sánchez M, Córdova C, Henríquez-Ch RA. Default Mode Network, Meditation, and Age-Associated Brain Changes: What CanWe Learn from
the Impact of Mental Training on Well-Being as a Psychotherapeutic Approach? Neural Plast 2019 Apr 2; 2019: 7067592. doi: 10.1155/2019/7067592. eCollection 2019
22. Bergner TMH. Burnout bei Ärzten. Schattauer, Stuttgart 2007